Neurechte Erzählgemeinschaften und konservative Krisennarrative

Rechtes Denken wird oft über einzelne Ideologieelemente wie Ultranationalismus oder Antisemitismus definiert. In „Die Erzählgemeinschaft der Neuen Rechten“ entwickelt Felix Schilk einen neuen erzähltheoretischen Zugang zu rechter Ideologie. Durch diesen Ansatz wird deutlich, wie rechtes Denken an kulturkritische Alltagsdeutungen anschließt und langfristig das kulturelle Wissensrepertoire der Gesellschaft prägt.
Tagungsbericht: Rechtsextreme Einflussnahmen vom Jugendzentrum bis zum Arbeitsplatz
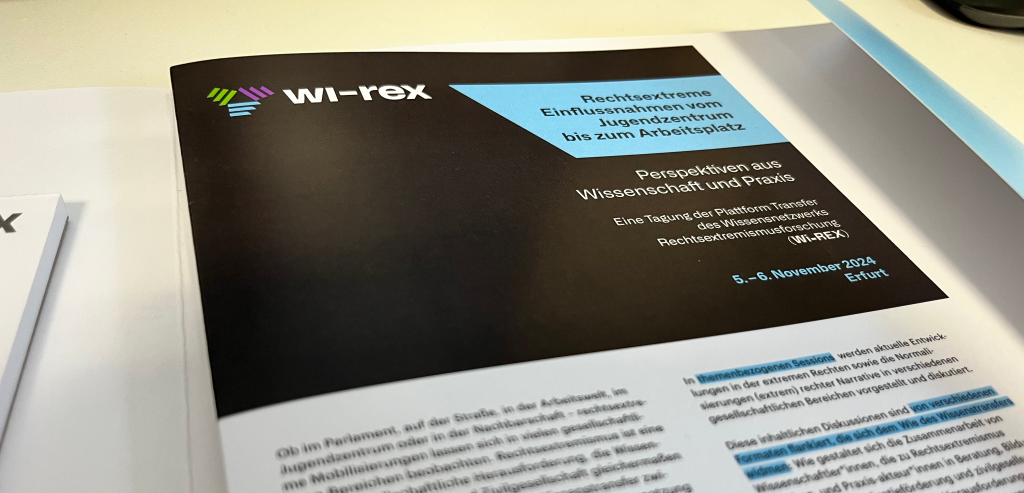
Lokale Jugendarbeit, Gewerkschaften, CSDs: Die extreme Rechte nutzt ganz unterschiedliche Bereiche und Anlässe, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Welche Dynamiken lassen sich aktuell beobachten? Und wie kann Wissenstransfer im vielfältigen und ausdifferenzierten, aber auch dezentralen und durch kurze Projektlaufzeiten geprägten Forschungs- und Praxisfeld Rechtsextremismus gelingen? Diese Fragen standen im Zentrum der Wi-REX-Tagung ‚Rechtsextreme Einflussnahmen vom Jugendzentrum bis zum Arbeitsplatz‘ mit mehr als 70 Teilnehmenden Anfang November 2024 in Erfurt. Dabei wurden als Kernaspekte für erfolgreichen Transfer insbesondere die Bedeutung von Zeit, Vertrauen und Schutz diskutiert.
Reflexionen über Emotionen und Affekte in der Forschung zur radikalen Rechten

Die Forschung zur radikalen Rechten ist geprägt von methodischen, ethischen und persönlichen Herausforderungen – Herausforderungen, die nach wie vor unzureichend diskutiert und institutionell angegangen werden, sodass sich Forschende mit ihnen häufig alleingelassen fühlen. In diesem Blogbeitrag nimmt Christoph Hedtke die Rolle von Emotionen und Affekten im Forschungsprozess in den Blick: Wie beeinflussen sie die Forschung? Welche Belastungen entstehen? Wie kann und sollte Forschung anders gestaltet sein?
20 Jahre Mailingliste Rechtsextremismusforschung: Eine Erfolgsgeschichte des wissenschaftlichen Austauschs

Die Mailingliste Rechtsextremismusforschung ist ein etablierter Kommunikationskanal innerhalb der wissenschaftlichen Community. 2004 von einer Arbeitsgruppe um Andreas Klärner und Thomas Grumke eingerichtet, gibt es sie nun seit 20 Jahren. In diesem Beitrag blicken die beiden Wissenschaftler auf die Entstehungsgeschichte der Liste zurück und verraten ihr Erfolgsrezept.
Trans*feindlichkeit: Forschungsbedarf eines Themas zwischen Bedrohungsnarrativen und Demokratiegefährdung

In diesem Beitrag führt Cynthia Freund-Möller in das Thema Trans*feindlichkeit ein, beschreibt das Phänomen und seine „Scharnierfunktion“ im Kontext rechtsextremer Bedrohungen und Demokratiegefährdung. Sie skizziert zudem, wie gegen Trans*feindlichkeit in der Gesellschaft besser vorgegangen werden könnte auf der Grundlage des Forschungsprojekts Trans*feindlichkeit: Kontexte, aktuelle Dynamiken und Auswirkungen.
Rechtspopulismus und Homosexualität: Eine Ethnografie der Feindschaft
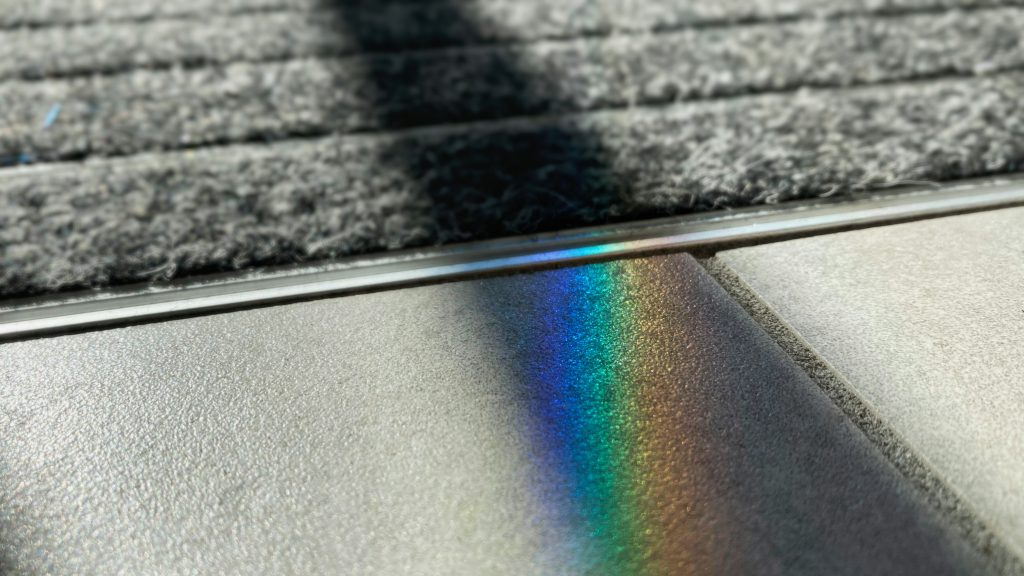
In diesem Beitrag stellt der Kulturanthropologe Patrick Wielowiejski seine kürzlich im Campus-Verlag erschienene Monografie „Rechtspopulismus und Homosexualität: Eine Ethnografie der Feindschaft“ vor.
Ostdeutsche Landtagswahlen im Fokus: Wie groß ist die Bedrohung durch Rechtsextremismus?

Nachdem im Mai und Juni auf der kommunalen Ebene gewählt wurde, finden im September in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen statt. Gideon Botsch von der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle (EJGF) der Universität Potsdam, Marius Dilling vom Else-Frenckel-Brunswik-Institut (EFBI) der Universität Leipzig und Cornelius Helmert vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena diskutieren im Gespräch mit Viktoria Kamuf vom Wi-REX die bisherigen Wahlergebnisse, ihre Folgen für die demokratische Kultur und wie demokratische Spielräume wieder vergrößert werden könnten.
Debatten und Herausforderungen der soziologischen Rechtsextremismusforschung – Ein Konferenzbericht
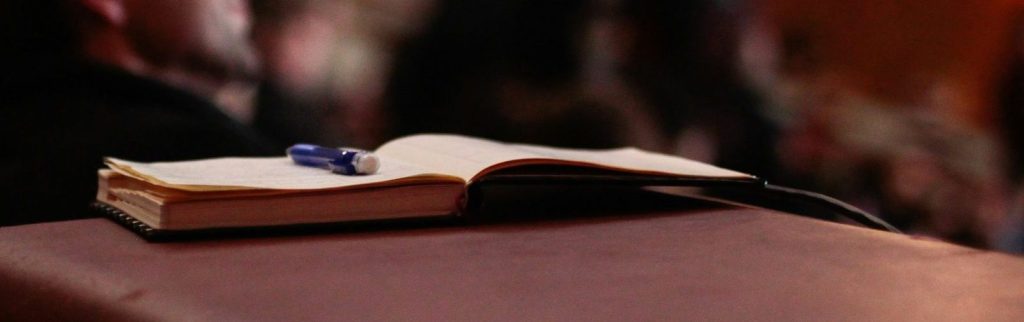
Was macht die Rechtsextremismusforschung als Forschungsfeld aus? Wie sieht eine spezifisch soziologische Perspektive auf Rechtsextremismus aus? Und welche strukturellen, thematischen, methodischen und konzeptionellen Herausforderungen stellen sich einer soziologischen Rechtsextremismusforschung? Zu diesen Fragen diskutierten am 14. und 15. März 2024 Rechtsextremismusforscher*innen aus unterschiedlichen Institutionen, Regionen und Fachdisziplinen beim Workshop „Konjunkturen und Schwerpunkte soziologischer Rechtsextremismusforschung“ im Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Eingeladen hatte der Arbeitskreis Sociology of the far right. Marc Blüml und Viktoria Kamuf diskutieren im Beitrag die zentralen Debatten und Erkenntnisse des Workshops.
Ethische Herausforderungen in der Forschung zur extremen Rechten
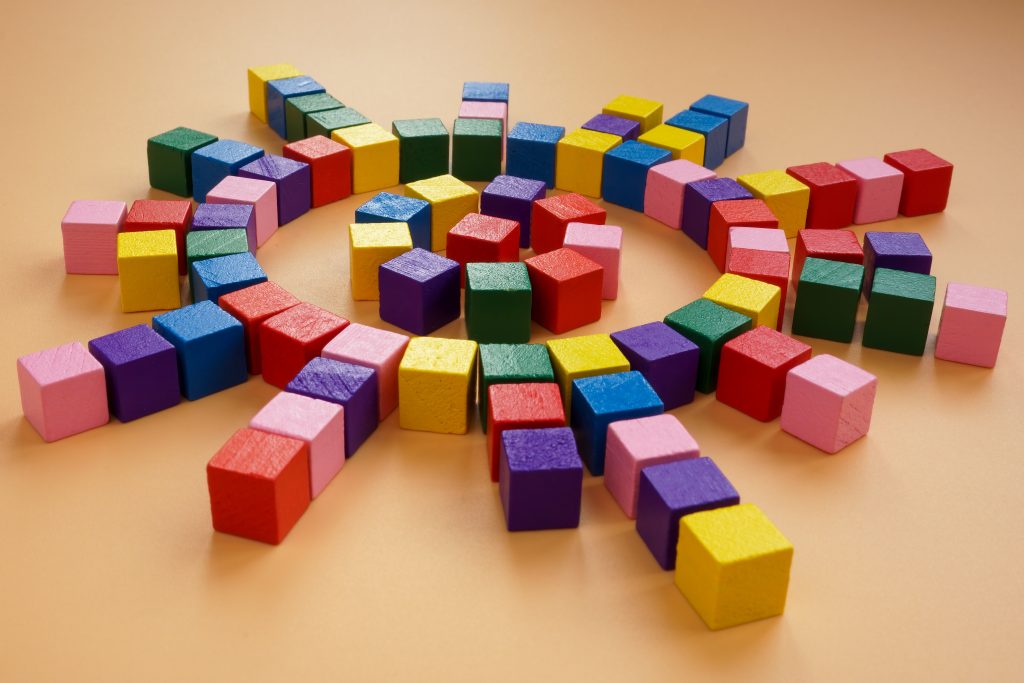
Wie sollten Forschende im Bereich des Rechtsextremismus mit ethischen Herausforderungen umgehen? Welche Rolle spielen Sicherheitskonzepte, institutionelle Leitlinien, Reflexivität, Macht, Emotionen, Supervision und Aspekte wie Self Care bei deren Bewältigung? Diese Fragen standen im Zentrum einer Podiumsdiskussion auf der internationalen Konferenz „Dimensions of Right-Wing Extremism in Europe“, die Paul Erxleben in diesem Beitrag wiedergibt und reflektiert.
Rechtsextremismus als Meme – Impulse für eine digitale Rechtsextremismusforschung

Der Rechtsextremismus hat in seiner Geschichte wohl bisher nie so eine starke Veränderung erfahren wie im Kontext der Digitalisierung. Dieser Herausforderung muss auch die Forschung gerecht werden. Im Beitrag diskutiert Maik Fielitz diese Veränderungen und gibt Impulse für eine digitale Rechtsextremismusforschung.

