Reflexionen über Emotionen und Affekte in der Forschung zur radikalen Rechten
von Christoph Hedtke
Die Forschung zur radikalen Rechten ist geprägt von methodischen, ethischen und persönlichen Herausforderungen – Herausforderungen, die nach wie vor unzureichend diskutiert und institutionell angegangen werden, sodass sich Forschende mit ihnen häufig alleingelassen fühlen. In diesem Blogbeitrag nimmt Christoph Hedtke die Rolle von Emotionen und Affekten im Forschungsprozess in den Blick: Wie beeinflussen sie die Forschung? Welche Belastungen entstehen? Wie kann und sollte Forschung anders gestaltet sein? Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema wird im März 2025 im Band „Das Ende rechter Räume. Zur Territorialisierung der radikalen Rechten“ erscheinen.
Es war ein Pausengespräch im DFG-Netzwerk Terra R – Territorialisierungen der radikalen Rechten, das am Anfang einer intensiveren Auseinandersetzung mit meiner eigenen Forschung und zahlreichen reflexiven Interviews mit anderen Forschenden stand. Wir hatten gerade eine Videoaufzeichnung einer rechten Kundgebung gesehen. Während einige berichteten, wie sehr die Aufnahme sie schockiert hatte, kam bei anderen und mir die Frage auf, warum zumindest dieses Video bei uns nicht so viel ausgelöst hat, warum wir es so unterschiedlich erlebten? Als erste Vermutung wurde geäußert, dass man bei der Arbeit zur radikalen Rechten mit der Zeit abstumpfen würde. So naheliegend diese Annahme auch ist, schien sie uns zu kurz zu greifen, wussten wir doch um andere Momente in unserer Forschung, in denen uns bereits ganz ähnlich ergangen war.
Es folgten weitere Gespräche unter Kolleg:innen, auf Methodenworkshops und Konferenzen und mich bewegte immer mehr die Frage, was die Präsenz und Wirkung von Affekten und Emotionen in unserer Forschung zur radikalen Rechten eigentlich methodologisch bedeutet. Ich begann, Gruppen- und Einzelinterviews mit Wissenschaftler:innen aus diesem Feld zu führen[1], darüber, wie sie ihre Forschung emotional erleben und wie sie mit diesem Aspekt ihrer Arbeit umgehen. Dass die vermeintliche Objektivität und Distanziertheit der Forschung nicht nur in Frage zu stellen ist, sondern auch die eigenen Gefühle[2] produktiv in die Forschung und Erkenntnisproduktion einbezogen werden sollten, wird vor allem in feministischer und postkolonialer Forschung zwar schon lange debattiert, in der Forschung zur radikalen Rechten bleibt dies jedoch weiterhin die Ausnahme.
Hatte ich anfänglich vor allem ein methodologisches Interesse, wurde mir mit jedem der Gespräche bewusster, dass Forschung zu und mit der radikalen Rechten eben immer auch heißt, sich mit Einstellungen und Praktiken zu beschäftigen, denen Gewalt inhärent ist. Diese Gewalt wird folglich zum Bestandteil unserer Forschung. Mir wurde immer klarer, dass sie dabei vielfältige und bisweilen sehr subtile Formen annimmt und sich auf uns Forschende auswirkt, selbst wenn wir nicht direktes Ziel sind. Die Folgen dieser wiederholten direkten oder indirekten Konfrontation mit symbolischer, verbaler oder auch physischer Gewalt sind bei jeder Person unterschiedlich und bleiben durch Verdrängung und mangelnde Aufmerksamkeit der Betroffenen häufig sogar lange unbewusst, sodass die Folgen akkumulierter Erfahrungen und Belastungen teilweise erst langfristig sichtbar werden. Schon 1998 schrieb Kathleen Blee über die Notwendigkeit kontinuierlicher Reflexion und Selbstregulation in diesem Forschungsfeld, da die Emotionen einerseits von heuristischer und hermeneutischer Relevanz sind, und andererseits psychische Belastungen bis hin zu Traumatisierungen zur Folge haben können. Und dennoch erhält das Thema emotionaler Belastung in der Forschung zur radikalen Rechten, sei es durch Anfeindungen und Angriffe oder im Sinne einer sekundären Traumatisierung durch die langfristige Exponierung der Wissenschaftler:innen gegenüber gewaltvollen Inhalten, immer noch nur zögerliche Aufmerksamkeit. Dies hat auch zur Folge, dass in diesem Wissenschaftsbereich häufig unzureichende institutionelle Strukturen und Unterstützungssysteme existieren, wie Meredith L. Pruden jüngst in ihrem Essay mit dem bezeichnenden Titel „Burn after Reading“ (2024) am eigenen Beispiel aufzeigt und kritisiert.
Doch auch wenn die Mehrheit der Wissenschaftler:innen in diesem Feld glücklicherweise keine Traumatisierung erleben und Belastungserscheinungen meist temporär bleiben, kann davon ausgegangen werden, dass herausfordernde und belastende Gefühle in der Forschung zur radikalen Rechten besonders präsent sind und diese damit unumgänglich beeinflussen. Dies bestätigte sich auch vielfach in meinen Interviews. In diesen berichteten meine Gesprächspartner:innen, wie das emotionale Erleben an unterschiedlichsten Punkten ihres Forschungsprozesses, also von der Entwicklung einer bestimmten Forschungsfrage über die Erhebung und Analyse bis hin zur Veröffentlichung präsent und damit auch wirksam ist. Warum dieser Aspekt jedoch in Vorträgen, Publikationen oder methodologischen Debatten unserer Disziplin nur selten thematisiert wird, darüber kann ich nur spekulieren. Dass es nicht zuletzt auch an dem weiterhin wirkmächtigen Paradigma der objektiven und distanzierten Forschung sowie der verbreiteten Gegenüberstellung von Gefühl und Vernunft, bzw. der Abgrenzung von Emotionen und Affekten von der Kognition, liegt, ist anzunehmen. Denn wie es Rebecca Campbell mit Blick auf die Wissenschaft pointiert zusammenfasst: „The feeling rules are that there are no feelings“ (2002: 104). Diesen Vorstellungen zum Trotz wurde in allen Interviews deutlich, dass die Forschenden permanent „emotionale Arbeit“ (Hochschild 1979) leisten, oft ohne sich dessen vollends bewusst zu sein, wie einige Gesprächspartner:innen selbst reflektierten. Dabei ist nicht nur ihre empirisch-analytische Arbeit, sondern auch ihr psychisches Wohlbefinden deutlich davon geprägt.
Obwohl die Wissenschaftler:innen immer wieder auch über positive Gefühle wie Freude und Neugierde in ihrer Forschung sprachen, die zur Motivation und Fortführung der Forschung beitragen, waren es mehrheitlich negativ konnotierte Gefühle wie Angst, Wut und Ekel, die häufig zu Distanzierung, Abwehr und Unsicherheiten führen. Dabei ist ihr emotionales Erleben durchaus vielseitig und die begleitenden Emotionen keineswegs immer eindeutig. Vielmehr berichteten sie von einer Vielzahl und teilweise auch Gleichzeitigkeit unterschiedlicher und diffuser Empfindungen. Dieser „Gefühlscocktail“, wie es eine interviewte Person nannte, führt bisweilen zu Verwirrung, Ratlosigkeit oder methodischer Unsicherheit und erfordert permanente Regulation. Gerade in der interaktiven Forschung erleben die Interviewteilnehmer:innen immer wieder Situationen, die sie als ambivalent und herausfordernd wahrnehmen, weil Momente scheinbar harmloser Interaktion häufig eine widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Empathie und Aversion mit sich bringen. So werden diese sozialen Situationen und Forschungsbeziehungen in der Datenerhebung auf vielfältige Art und Weise als schwierig erlebt, da die Forschenden beispielsweise mit Personen und Aussagen konfrontiert werden, die ihnen politisch fernliegen, die sie grundlegend ablehnen – und zugleich kann es auf persönlicher Ebene ein freundliches und höfliches Gespräch mit einer Person sein, für deren Lebensumstände und Perspektiven sie möglicherweise auch ein gewisses Verständnis haben. In diesem Spannungsfeld stellen sich immer wieder Fragen wie: Wird ein bestätigendes und die Narrationen förderndes Nicken von dem Gegenüber vielleicht als Zustimmung und Bestärkung aufgefasst? Verstelle ich mich und verschleiere so meine Haltung oder Positionierung und täusche damit mein Gegenüber? Sollte oder kann ich meine Position und Positionierung überhaupt verbergen? Wie bewahre ich mich vor Vereinnahmungsversuchen?
Doch nicht nur im direkten Kontakt mit Menschen, sondern auch in der Forschung aus der vermeintlichen Distanz mit Daten wie Texten oder audio-visuellem Material, gehen die Forschenden einen Kontakt und situative Nähe ein, die emotionale Herausforderungen mit sich bringt. Beispielsweise beschrieben sie wiederkehrende Gefühle des angegriffen oder beschmutzt Werdens und damit einhergehende Momente wütender Abwehr und Distanzierung vom Material. Und das, obwohl sie sich zugleich bewusst sind, dass dies im Widerspruch zur angestrebten und notwendigen methodischen Offenheit steht. Die Forschenden befinden sich so in einem permanenten Spannungsverhältnis zwischen methodischer Offenheit, analytischer Distanz und eigener Haltung, was zwar eine generelle Herausforderung in der Wissenschaft darstellt, sich in diesem Feld aber besonders zeigt. Dieses Balancieren von Involvierung und Distanzierung setzt sich in der Interpretation und im Schreiben fort. So beschäftigen die Interviewpartner:innen auch hier zahlreiche Fragen und Unsicherheiten: Wie kann ich differenziert über das Feld schreiben, ohne rechte Positionen zu reproduzieren, aufzuwerten und Relevanz zu verschaffen? Was erwartet das Feld von mir und wie reagiert es auf die analytische Einordnung? Welche Erwartung hat eine wissenschaftliche Community an meine Forschung oder auch Selbstpositionierung in diesem politisch und moralisch aufgeladenen Feld? Welche Erwartungen habe ich diesbezüglich an mich selbst als Forschende:r und auch als politisches Subjekt? Und nicht zu vergessen: Was passiert, wenn ich mich und meine Forschung öffentlich exponiere und welchen Rückhalt habe ich dann?
Es sind eine Vielzahl an methodischen, ethischen und auch sicherheitsbezogenen Fragen, die sich in anderen Forschungskontexten nicht auf diese Weise stellen, weshalb es den Wissenschaftler:innen nach eigenen Angaben häufig an Erfahrungswissen, feldspezifischen Handlungsanleitungen und Austausch mit anderen mangelt. Es sind Fragen, in denen sich viele meiner Interviewpartner:innen mehr Orientierung wünschen. Und es sind Fragen, die eng mit dem emotionalen Erleben verbunden sind, da sie immer wieder zu Unwohlsein und Handlungsunsicherheiten und somit auch zu Belastungen im Forschungsprozess beitragen. Obwohl in allen Interviews zahlreiche und unterschiedlichste emotionale Belastungen genannt wurden, bezeichneten viele diese eher als hintergründige Aspekte der Forschung, denen sie wenig Aufmerksamkeit widmen, sodass die Folgen oft unbemerkt bleiben oder verdrängt werden. Andere beschrieben hingegen, dass die Belastungen dazu führten, dass sie sich vom Material, teilweise aber auch vom Thema distanzierten, bestimmte Zugänge mieden oder sich gar schon ganz aus dem Forschungsfeld zurückgezogen haben. Auch scheuten einige den Erkenntnistransfer durch öffentliche Präsentationen oder die aktive Bekanntmachung eigener Forschungsergebnisse, beispielsweise durch Interviews oder Social Media Beiträge. Zugleich beschrieben nur Wenige einen bewussten Umgang mit dem emotionalen Erleben, indem sie dieses bewusst reflektieren und aktiv verarbeiten. Nur vereinzelt machten Wissenschaftler:innen die Gefühle auch erkenntnistheoretisch produktiv, beispielsweise mit Hilfe tiefenhermeneutischer oder autoethnographisch inspirierter Ansätze.
Doch selbst wenn diese emotionalen Belastungsmomente zunächst unbeachtet und unterschwellig bleiben, wird die Forschung von vielen als anstrengend und ermüdend empfunden, was sich in einer Mischung aus Erschöpfung, Hilflosigkeit, Verwirrung, Überstimulation und Abwehr äußert. Teilweise zeigen sich die Belastungsfolgen in körperlichen Symptomen wie Zittern nach Gesprächssituationen, Albträumen und Schlafstörungen sowie in allgemeiner Anspannung. Die individuellen Auswirkungen der Forschung sind jedoch ganz unterschiedlich und verändern sich im Prozess immer wieder. Hierbei scheint insbesondere eine Rolle zu spielen, wie die Forschenden positioniert sind, welche biografischen Erfahrungen sie gemacht haben und unter welchen Rahmenbedingungen sie diese Forschung durchführen. Haben sie beispielsweise in ihrer Jugend Gewalterfahrungen mit Rechten gemacht? Sind sie nur mit Kurzzeitverträgen angestellt, promovieren sie weitgehend „alleine“ oder gibt es Austauschräume, um über schwierige Aspekte der Forschung und ihre „Nebenwirkungen“ zu sprechen? Ist die eigene Forschungsinstitution für die spezifischen Herausforderungen in diesem Forschungsfeld und unterschiedliche Positionierungen, Betroffenheiten und Gefährdungen sensibilisiert und bietet sie Rückhalt sowie die notwendigen Infrastrukturen? Welche anderen individuellen Herausforderungen hängen mit der eigenen Biografie zusammen oder kommen in der aktuellen Lebensphase hinzu?
Dennoch handelt es sich trotz verschiedener Rahmenbedingungen und individuell unterschiedlichem Erleben nicht, dies sollte deutlich geworden sein, um individuelle Schwierigkeiten oder gar Unzulänglichkeiten, die lediglich individuell durch Schulungen, Selbstfürsorge oder Resilienzstärkung zu bewältigen sind. Stattdessen sind es vielfach kollektiv geteilte Erfahrungen auf Grund von feld- und kontextspezifischen sowie strukturell bedingten Aspekten, die folglich einen gemeinsamen und institutionalisierten Umgang erfordern. Gerade letzteres scheint mir mit Blick auf die Interviews für das emotionale Erleben und die Möglichkeiten des Umgangs damit besonders relevant zu sein. Jedoch wurde ausgerechnet der institutionelle und infrastrukturelle Rahmen für die spezifischen Herausforderungen in diesem Forschungsfeld von vielen meiner Gesprächspartner:innen als unzureichend empfunden, sodass sie sich mit den Herausforderungen teilweise alleingelassen fühlen. Vor diesem Hintergrund betonten sie vielfach die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs als unterstützend und zentral für die Bewältigung der Herausforderungen und Belastungen. Dieser Austausch und gegenseitige Unterstützung verbleiben jedoch oft im privaten oder engen kollegialen Umfeld. Nur selten wurde der Austausch institutionalisiert, etwa in Form von kollegialer Beratung und Intervision oder in einem professionellen Setting wie einer Forschungssupervision.
Vor diesem Hintergrund und rückblickend auf die Gespräche halte ich es für unbedingt notwendig, sich schon vor Forschungsbeginn die besonderen methodischen und emotionalen Herausforderungen sowie die rechten Ideologien inhärente Gewalt bewusst zu machen. Auch sollte das Studiendesign und seine Rahmenbedingungen vorausschauend gestaltet werden – in Abhängigkeit von Positionalität, tatsächlich verfügbaren individuellen und institutionellen Ressourcen sowie angepasst an die jeweiligen Sicherheitsbedürfnisse. Denn neben der psychischen Belastung im Kontakt mit Forschungsteilnehmer:innen oder Material kann die Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten potentiell auch immer dazu führen, Ziel von Anfeindungen, Drohungen oder gar körperlichen Angriffen zu werden, wie es auch von einigen meiner Gesprächspartner:innen mit entsprechenden Konsequenzen erlebt wurde. Hierbei ist meines Erachtens auch zu berücksichtigen, dass angesichts der aktuellen massiven Veränderungen der politischen Machtverhältnisse Verwundbarkeiten und Risiken in Zukunft möglicherweise anders zu bewerten sind und deshalb nicht nur mit Blick auf den gesellschaftlichen Status quo betrachtet werden sollten. Da die Konsequenz jedoch nicht sein kann und darf, Forschung zur radikalen Rechten nicht mehr zu betreiben, ist nicht die Frage ob die Wissenschaftler:innen stark oder hart genug sind, sondern was es braucht, damit sie diese Forschung gut, sicher und wohlbehalten durchführen können.
Basierend auf den Interviews sowie auf Erfahrungen aus anderen sensiblen Arbeitskontexten wie der sozialen Arbeit, Opferberatungsstellen oder dem Journalismus habe ich in Zusammenarbeit mit Kristine Beurskens in dem Terra R-Buchbeitrag mögliche Handlungsstrategien, Maßnahmen und Reflexionsfragen für die individuelle, kollektive und institutionelle Ebene zusammengetragen (siehe https://terra-r.net/material/hinweise-und-reflexionsfragen-fuer-die-forschungspraxis/). Diese sollen dabei helfen, auf individueller, kollektiver und institutioneller Ebene einen reflexiven und verantwortungsbewussten Umgang mit den zuvor beschriebenen Herausforderungen zu finden. Hierbei befanden wir uns in mindestens zwei Spannungsfeldern. Zum einen wollten wir für die Herausforderungen, potenziellen Belastungen und Gefährdungen in diesem Feld sensibilisieren, jedoch keinen Alarmismus betreiben und weder Bedenken noch Ängste hervorrufen oder verstärken. Zum anderen wollten wir einen umfassenden Überblick geben, konnten aber aus Gründen der Sicherheit nicht alle Maßnahmen und Strategien offenlegen. Auch deshalb plädieren wir dafür, sich unbedingt in Abhängigkeit von der Sensibilität der eigenen Forschung und der angesprochenen Risikobewertung einen geeigneten institutionellen Rahmen für das Vorhaben zu suchen und entsprechende Kontextsensibilität und Unterstützung dort auch einzufordern. Abschließend möchte ich rückblickend auf meine Gespräche mit den Wissenschaftler:innen, meine Forschung im Projektteam sowie meine Erfahrungen im DFG-Forschungsnetzwerk Territorialisierungen der radikalen Rechten unbedingt empfehlen, der Vereinzelung im akademischen Betrieb aktiv entgegenzutreten und sich mit anderen Forschenden zusammenzutun, sich auszutauschen (bspw. im Rahmen der Wi-Rex-Veranstaltungen oder dem C-REX-Webinar „Researching the Far Right: Methods and Ethics“), sich zu unterstützen sowie miteinander zu lernen und gemeinsam zu forschen.
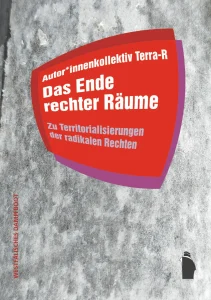
Veröffentlichungshinweis:
Eine ausführliche Auseinandersetzung von Christoph Hedtke und Kristine Beurskens mit Emotionen und Affekten in der Forschung zur radikalen Rechten findet sich in dem Buch Das Ende rechter Räume. Zu Territorialisierungen der radikalen Rechten. Das Buch wurde erdacht, kuratiert und verfasst vom Autor*innenkollektiv Terra-R und erscheint im März 2025 im Verlag Westfälisches Dampfboot. Es nimmt sich der Frage an, wie eine radikale Rechte im Aufschwung aus konkreten räumlichen Verhältnissen der Gesellschaft verstanden werden kann und schlägt dafür eine konzeptionelle Neuorientierung vor, erprobt diese am gesellschaftlichen Wirken rechter Mobilisierungen und Projekte und sucht darüber das kritische Gespräch mit Akteur*innen aus Forschung und politischer Praxis.
Literatur
Blee, K. M. (1998). White-knuckle research: Emotional dynamics in fieldwork with racist activists. Qualitative Sociology, 21, 381-399.
Campbell, R. (2002). Emotionally involved: The impact of researching rape. Routledge: New York.
Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Journal of Sociology, 85(3), 551-575.
Pruden, M. L. (2024). Burn after Reading: Research-Related Trauma, Burnout, and Resilience in Right-Wing Studies. Journal of Right-Wing Studies, 2(1). 152-163.
Straub, J. (2024). Interkulturalität zwischen Konflikt und Koexistenz.
Fußnoten
[1] Die Fokusgruppen- und problemzentrierten Interviews wurden in den Jahren 2023 und 2024 geführt. Hierbei wurden auch Methoden wie Schreibübungen, Positionierungen und sogenannte Emotionskarten eingesetzt. Insgesamt waren 39 Forscher*innen aus insgesamt 23 unterschiedlichen Forschungseinrichtungen beteiligt. Die Teilnehmenden unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Disziplinen forschen allesamt qualitativ und standen zum Zeitpunkt des Interviews an unterschiedlichen Punkten im akademischen Leben. Hatten drei Personen erst kürzlich ihren Masterabschluss erworben, waren die meisten Gesprächspartner*innen seit mindestens fünf Jahren in der Forschung tätig. Etwa mehr als die Hälfte der Beteiligten war bereits promoviert. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des Projektes www.lokonet.de, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderkennzeichen: 01UG2201A, Laufzeit: 04.2022 – 03.2026
[2] Der hier verwendete Gefühlsbegriff fungiert als Oberbegriff, der Emotionen und Affekte umfasst und deren Erlebniskomponente betont (vgl. Straub 2024).
Schlagwörter
- Forschungsansätze & Methoden
Veröffentlichungsdatum
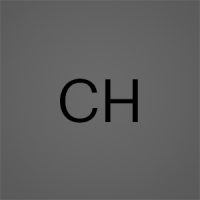
Christoph Hedtke
Christoph Hedtke ist Sozialgeograph und arbeitet am der FH Erfurt im Forschungskollektiv Peripherie und Zentrum. Dort forscht er zu lokalen Konflikten und interessiert sich hierbei besonders für die Bedeutung von Emotionen und Peripherisierung in Konfliktdynamiken sowie für radikal rechte Mobilisierungen und Projekte. Er ist Teil des DFG-Netzwerkes und gleichnamigen Autor*innenkollektivs Terra R.
Mail: christoph.hedtke@fh-erfurt.de
Bluesky: @chedtke.bsky.social
Newsletter
Sie möchten über Angebote und Veranstaltungen des Wissensnetzwerks Rechtsextremismusforschung informiert bleiben? Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an:

